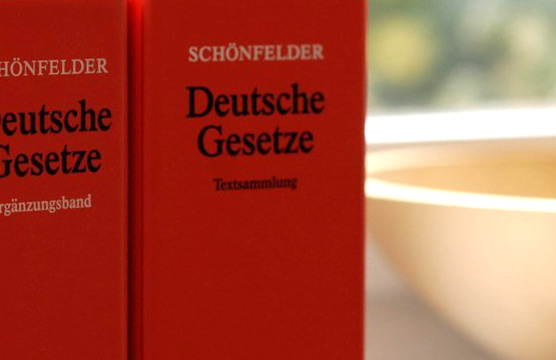Zur gerichtlichen Vertretungsbefugnis des Kindes für die Geltendmachung des Kindesunterhalts
In dem vorliegenden Fall streiten die Beteiligten über Kindesunterhalt für zwei Kinder, die 2012 und 2015 geboren wurden. Die Eltern der Kinder sind nicht verheiratet, jedoch gemeinsam sorgeberechtigt. Im April 2022 vereinbarten sie eine Regelung zur Betreuung der Kinder, wonach diese an den Wochenenden und in den Schulferien hälftig auf beide Elternteile aufgeteilt werden. Ansonsten leben die Kinder beim Vater, während die Mutter sie an sieben Tagen im Monat, abhängig vom Dienstplan des Vaters, betreut. Streitpunkt ist, ob die Kinder überwiegend in der Obhut des Vaters sind oder ob ein sogenanntes Wechselmodell vorliegt.
Der Vater beantragte im Namen der Kinder laufende und rückständige Unterhaltszahlungen von der Mutter ab Juni 2022 sowie die Auszahlung des hälftigen Kindergeldes für die Zeit von Juni bis Oktober 2022. Das Amtsgericht Fürstenfeldbruck wies diesen Antrag als unzulässig ab, da es der Auffassung war, der Vater sei nicht befugt, die Kinder zu vertreten. Der Vater legte daraufhin Beschwerde ein und erweiterte in der Beschwerdeinstanz den Antrag, sodass das hälftige Kindergeld direkt an die Kinder gezahlt werden solle. Das Oberlandesgericht München wies die Beschwerde des Vaters zurück.
Der Bundesgerichtshof hob jedoch die Entscheidungen der Vorinstanzen auf und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung an das Oberlandesgericht zurück. Der BGH begründete seine Entscheidung damit, dass der Vater, unabhängig davon, ob die Kinder sich in seiner Obhut befinden oder ein Wechselmodell vorliegt, zur Vertretung der Kinder berechtigt ist. Laut § 1629 BGB können Eltern, die gemeinsam sorgeberechtigt sind, ihre Kinder vertreten, wobei im Fall von Unterhaltsansprüchen der Elternteil, in dessen Obhut sich die Kinder befinden, den Unterhalt geltend machen kann. Da im vorliegenden Fall die Betreuungssituation nicht eindeutig zugunsten eines Elternteils entschieden werden kann, stellte der BGH klar, dass der Vater ebenso vertretungsberechtigt ist.
Damit muss das Oberlandesgericht die Sache erneut prüfen und sich mit der inhaltlichen Begründung der Unterhaltsansprüche auseinandersetzen. Der Bundesgerichtshof betonte zudem, dass die Vertretungsbefugnis in Fällen wie diesem nicht automatisch einem Ergänzungspfleger übertragen werden muss, solange keine erheblichen Interessenkonflikte zwischen den Eltern und Kindern bestehen.
BGH, Az.: XII ZB 459/23, Beschluss vom 10.04.2024, eingestellt am 15.09.2024