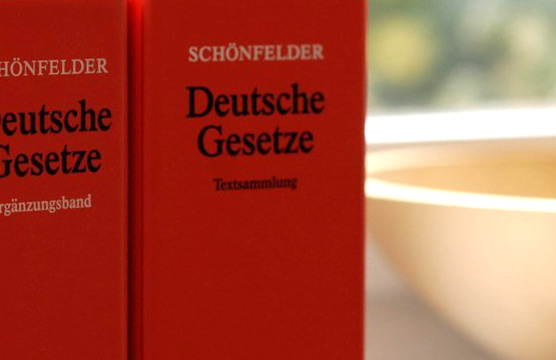Sittenwidrige Verknüpfung von Ansprüchen im gerichtlichen Vergleich
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Verknüpfung von vermögensrechtlichen Ansprüchen mit Umgangsregelungen in einem gerichtlichen Vergleich als sittenwidrig nach § 138 BGB eingestuft. Im zugrunde liegenden Fall hatten die Parteien, ein geschiedenes Ehepaar, im Rahmen eines Zugewinnausgleichsverfahrens eine Vereinbarung getroffen, die die Zahlung von Raten an die Kindsmutter an den Umgang des Vaters mit den gemeinsamen Kindern in Deutschland knüpfte. Die Mutter hatte später die Unwirksamkeit des Vergleichs geltend gemacht, da dieser ihrer Ansicht nach gegen das Kindeswohl verstoße.
Der BGH stellte fest, dass eine solche Verknüpfung problematisch ist, da sie wirtschaftlichen Druck auf einen Elternteil ausübt und das Kind in Loyalitätskonflikte bringen kann. Insbesondere bemängelte der BGH, dass die Fälligkeit der Ratenzahlungen von der Durchführung eines dreitägigen Umgangs ohne gerichtliche Kontrolle abhängig gemacht wurde. Der Vergleich enthielt keine Möglichkeit für die Mutter, bei einer Kindeswohlgefährdung den Umgang zu verweigern, ohne finanzielle Nachteile zu erleiden. Dies stelle eine unzulässige Kommerzialisierung des Umgangsrechts dar.
Zudem hob der BGH hervor, dass eine gerichtliche Kontrolle der Umgangsvereinbarung auf ihre Vereinbarkeit mit dem Kindeswohl nicht stattgefunden hatte. Zwar hatte das Amtsgericht München den Vergleich ursprünglich gebilligt, doch war diese Entscheidung vom Oberlandesgericht aufgehoben worden, da keine ausreichenden Ermittlungen zum Kindeswohl durchgeführt worden waren. Die Kinder waren weder angehört noch ihre Wünsche berücksichtigt worden.
Der BGH betonte, dass Eltern zwar grundsätzlich über den Umgang entscheiden können, dies jedoch stets am Maßstab des Kindeswohls zu messen sei. Eine Vereinbarung wie im vorliegenden Fall entziehe sich jedoch einer solchen Kontrolle und sei daher unwirksam. Der Beschluss stärkt damit die Rechte von Kindern und stellt klar, dass deren Wohl bei Umgangsregelungen oberste Priorität hat.
Abschließend verwies der BGH darauf, dass auch in Fällen mit Auslandsbezug – wie hier aufgrund des Wohnsitzes der Kinder in Peru – eine gerichtliche Kontrolle notwendig bleibt. Die Sache wurde zur weiteren Klärung an das Oberlandesgericht zurückverwiesen, insbesondere um zu prüfen, ob der Vergleich auch ohne die sittenwidrigen Klauseln Bestand haben könnte.
BGH, Az.: XII ZB 385/23, Beschluss vom 31.1.2024, eingestellt am 15.04.2025