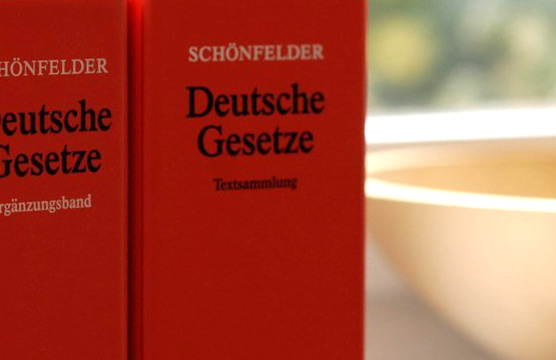Wechselseitige Kindesentführung und gerichtliche Zuständigkeit im internationalen Kontext
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsbeschwerde im Sorgerechtsfall zwischen einer deutschen Mutter und dem in Dänemark lebenden Vater ihrer zwei jüngeren Kinder ist auf eine Vielzahl von gerichtlichen Vorverfahren zurückzuführen. Die Kinder lebten nach der Trennung der Eltern zunächst bei der Mutter in Deutschland, wurden jedoch im Frühjahr 2021 vom Vater widerrechtlich in Dänemark zurückgehalten. Es folgten zahlreiche gerichtliche Auseinandersetzungen in beiden Ländern, die jeweils das Sorgerecht oder die Rückführung der Kinder betrafen. Die deutschen Gerichte hatten der Mutter zunächst das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht übertragen, während die dänischen Gerichte die Vollstreckung dieser Entscheidung ablehnten und die Rückführung der Kinder nach Deutschland verweigerten. Im Januar 2024 wurden die Kinder durch unbekannte Personen von Dänemark nach Deutschland gebracht, woraufhin beide Länder erneut gerichtlich tätig wurden. Das dänische Amtsgericht übertrug dem Vater vorläufig das Sorgerecht, während das deutsche Oberlandesgericht das Aufenthaltsbestimmungsrecht und das sogenannte „Erziehungsrecht“ ebenfalls auf den Vater übertrug und die Herausgabe der Kinder anordnete.
Die Beschwerdeführerin, die Mutter, rügte in ihrer Verfassungsbeschwerde insbesondere Verfahrensfehler und die Verletzung mehrerer Grundrechte, darunter das elterliche Sorgerecht (Art. 6 Abs. 2 GG), den Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) und den allgemeinen Justizgewährungsanspruch (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG). Sie warf den Fachgerichten unter anderem vor, die Kinder nicht angehört zu haben und sich nicht ausreichend mit ihrer Sichtweise beschäftigt zu haben.
Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass die Verfassungsbeschwerde teilweise unzulässig und teilweise unbegründet sei. Es sah keine Verletzung des elterlichen Sorgerechts, da die Auslegung und Anwendung des Kinderschutzübereinkommens (KSÜ) durch das Oberlandesgericht nicht auf einer grundsätzlich unrichtigen Auffassung des Grundrechts beruhte. Die Feststellung, dass die Kinder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Dänemark hätten, sei verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, da sie sich dort seit mehr als zwei Jahren familiär und sozial integriert hätten und auch der geäußerte Kindeswille berücksichtigt worden sei. Das Unterbleiben einer erneuten Kindesanhörung im Beschwerdeverfahren stelle zwar fachrechtlich ein Problem dar, verletze jedoch nicht das Grundrecht der Mutter. Auch der allgemeine Justizgewährungsanspruch sei nicht betroffen, da die Gerichte die notwendigen tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen für ihre Entscheidung geschaffen hätten. Die Rüge der Gehörsverletzung blieb ebenfalls erfolglos, weil die Gerichte die wesentlichen Argumente der Beschwerdeführerin berücksichtigt und sich mit ihnen auseinandergesetzt hätten.
Schließlich stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass die Verfassungsbeschwerde gegen die einstweiligen Anordnungen des Oberlandesgerichts unzulässig sei, da ein fortbestehendes Rechtsschutzbedürfnis nicht dargelegt worden sei. Insbesondere seien die angegriffenen Entscheidungen durch die nachfolgenden Beschlüsse im Hauptsacheverfahren außer Kraft getreten oder hätten sich erledigt. Auch völkervertragsrechtlich sei die Zuständigkeit der deutschen Gerichte nach Erlass der dänischen Entscheidung nicht mehr gegeben gewesen. Insgesamt blieb die Verfassungsbeschwerde daher ohne Erfolg.
BVerfG (2. Kammer des Ersten Senats), Az.: 1 BvR 1618/24, Beschluss vom 09.04.2025, eingestellt am 30.06.2025